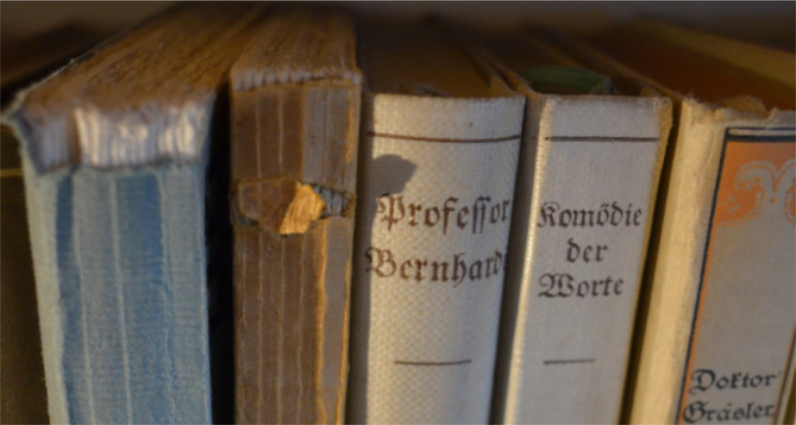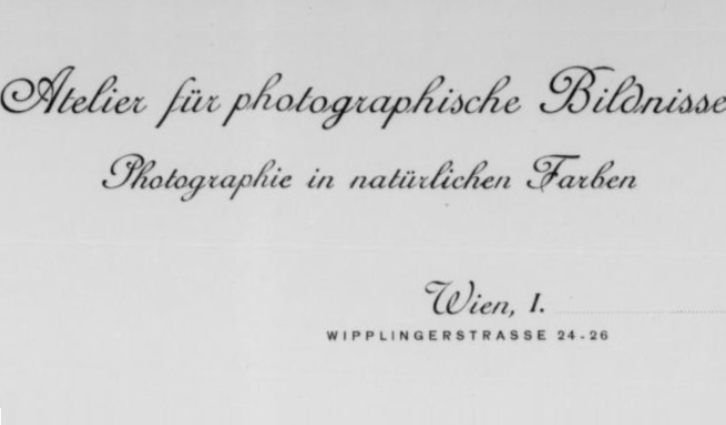Diese Website ist ein
Begleitprodukt zur Buchedition
»Arthur
Schnitzler, Hermann Bahr: Briefwechsel, Materialien, Dokumente
1891–1931«. Auf die im Buch vorgenommenen
Kürzungen von bereits publizierten Texten wie Schnitzlers
Tagebuch und Bahrs Aufzeichnungen aber auch der Briefe von und
an Dritte wird in der Online-Präsentation verzichtet. Das hat
den großen Vorteil, ein größeres durchsuchbares Textkorpus zur
Verfügung stellen zu können.
Die Buchausgabe erschien 2018 im Wallstein-Verlag.
Ein PDF (Open Access) des Buches kann auf oapen.org heruntergeladen werden
Warum ist diese Seite weiterhin aktuell?
Teile der vorliegenden Edition finden sich auch anderswo im Netz. Das Tagebuch Schnitzlers ist vollständig online –
doch nur bei den von uns herausgegebenen Daten sind indirekte Erwähnungen (»Bahr und
Frau«)
und Organisationen indiziert. Die Edition der beruflichen Korrespondenz Schnitzlers
(Briefe)
enthält nicht nur den Briefwechsel
Bahr – Schnitzler, sondern auch weitere Briefe, aus denen hier noch
aus Buchausgaben zitiert wird, dort aber nach den Originalen in Archiven (beispielsweise
Hofmannsthal, Beer-Hofmann).
Trotzdem enthält unsere Edition einige Briefe, die sich anderswo
nicht finden, etwa von Schnitzler und seiner Frau oder von Dritten an Bahr.
Dazu kommen noch weitere Texte, wie Kritiken und Erinnerungen, die hier
exklusiv vorliegen.